Vor einiger Zeit habe ich mir eine DVD-Box gekauft: Film Noir Collection, mit neun Filmen: The Killers; Double Indemnity; The Big Steal; Crossfire; Out of the Past; The Blue Dahlia; The Glass Key; This Gun For Hire; Murder, My Sweet. Ich mag seit früher Jugend film noir. Schwarzweißfilme waren ohnehin klasse, screwball comedies, Cary Grant, James Stewart, Katherine Hepburn, Humphrey Bogart.
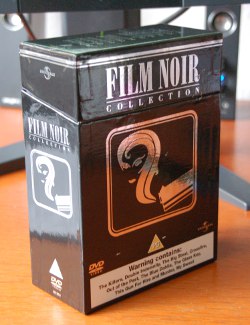
Noir, das war eine besondere Art Schwarzweißfilm. Ein Krimi, aber mit einem Privatdetektiv als Held, jedenfalls keinem Polizisten. Im Gegenteil, die Polizei war korrupt oder störend. Trenchcoats und Hüte, Zigaretten, nächtlicher Regen, Großstadt. Der Held löste den Fall, kriegte aber nicht unbedingt das Mädchen. Oft genug war sie die Täterin, eine femme fatale war jedenfalls meistens dabei. Der ideale Noir-Held blieb am Schluss des Films allein zurück, moralisch integer, etwas angewidert vom Rest der Welt, aber bereit für den nächsten Fall.
Erst danach, aber noch zur Schulzeit, habe ich die Bücher gelesen: Chandler und Hammett.
Noir gab’s natürlich auch moderner und in Farbe: Chinatown etwa oder Blade Runner, und dieser eine Film da, den ich vor fünfundzwanzig mal im Fernsehen gesehen und von dem ich seitdem nie wieder gehört habe: junger Mann will Detektiv werden, hat wohl zu viele Filme gesehen; Vater ist Polizist und will es ihm ausreden; ein Fall taucht auf, der dann verzwickter wird; verführerische Frau; Sohn bewährt sich. Viel mehr weiß ich nicht (außer: der Sohn übt, seine Zigarette so lässig an der unterlippe baumeln zu lassen wie Jean-Paul Belmondo), aber der Film hat mir gefallen und ich wüsste gerne, was das war.
In den Sommerferien bin ich endlich dazu gekommen, mir die ersten Filme aus der Box anzuschauen. Hier meine Gedanken dazu:
1. The Killers
Regie: Robert Siodmak
Drehbuch: Anthony Veiller
Darsteller: Burt Lancaster, Ava Gardner
Musik: Miklós Rózsa
Jahr: 1946
Guter Film, ein Klassiker, hatte ihn noch nie gesehen. Der Durchbruch für den jungen Burt Lancaster.
Motive: Treppen, Nacht, Hell-Dunkel-Kontraste, Verrat, femme fatale. Kein Regen.
Frauen: 3 – eine sympathische, brav-bürgerliche; ein Zimmermädchen; eine femme fatale (aber immerhin ohne Romanze mit dem Detektiv).
Bechdel-Test: nicht bestanden.
Erzählperspektive: verschachtelt, in Rückblenden.
Plot: Zwei Killer kommen in ein abgelegenes Städtchen und erschießen einen der Einwohner, den „Schweden“, der ihr Kommen untätig erwartet. (Soweit, wenn ich mich recht erinnere, die Hemingway-Kurzgeschichte, auf der der Film basiert.) Ein Versicherungsdetektiv untersucht den Fall und rollt in einer Reihe von Interviews mit verschiedenen Personen aus der Vergangenheit des Opfers dessen Geschichte auf; der Film ist weitgehend in Rückblenden erzählt – ich glaube den Einfluss von Citizen Kane zu erkennen. Es gibt zwei Helden, den Toten und den Detektiv, der schließlich auch den Fall aufklärt.
Die Musik vom geschätzten Miklós Rózsa ist natürlich erstklassig, das Killers-Motiv ist die Vorform des Dragnet-Themas und wurde dafür nur etwas erweitert.
Erzählerischer Schönheitsfehler: eine Person aus seiner Vergangenheit entdeckt den Schweden in dem Städtchen, in das er sich zurückgezogen hat. Das erfahren wir durch den Bericht des Tankwarts in Form einer Rückblende, wir sehen diese Person und erkennen sie aus anderen Rückblenden wieder – und wissen damit mehr als der Ermittler, obwohl wir auch keine anderen Zeugenaussagen gehört haben als er. Das ist das Problem mit visuell wiedergegeben Binnenerzählungen: es gilt die Regel, das derselbe Schauspieler stets dieselbe Person verkörpert und umgekehrt, so dass eine eindeutige Identifizierung möglich ist. Keine Verwechslung oder Hochstapelei ist möglich. Gespielt wird damit allenfalls in manchen Rashomon-Episoden.
2. Double Indemnity
Regie: Billy Wilder
Drehbuch: Billy Wilder und Raymond Chandler
Darsteller: Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson
Jahr: 1944
Romanvorlage: James M. Cain
Motive: Verrat, Misstrauen, femme fatale. Korrupte Autoritäten (MacMurray selber). Mit Streichhölzern Feuer geben. Kein Ermittler. Nur wenig Regen.
Frauen: eigentlich nur eine, diejenige des deutschen Titels: „Frau ohne Gewissen“
Bechdel-Test: nicht bestanden.
Erzählperspektive: Rahmenhandlung, der Hauptteil als Rückblende.
Plot: Fred MacMurray, Versicherungsverkäufer, schwankt verletzt in sein Büro und diktiert dort in ein Aufnahmegerät die wahre Geschichte eines Mordes und Versicherungsbetrugs. MacMurray selber ist es, der mit der Frau des Versicherten den Mord verübt hat. Die Versicherungsgesellschaft schöpft Verdacht und will erst einmal nicht zahlen, um die Witwe zu einem Gerichtsverfahren zu zwingen und so Zeit zu haben herauszufinden, wer ihr Mittäter ist.
Ein Klassiker, berühmt und so, aber trotzdem keiner meiner Favoriten. MacMurrays Besessenheit von Barbara Stanwyck kommt mir zu plötzlich, und auch wenn sie am Schluss als gewissenlose Manipulatorin hingestellt wird, so geht die Tat tatsächlich doch eher von MacMurray aus. Die besten Teile des Filmes (neben den Szenen mit Edward G. Robinson) sind die Szenen nach dem Mord, als MacMurray und Stanwyck mürbe gemacht werden. Aber das ist in der Buchvorlage schöner – Kunststück, da ist auch mehr Zeit dafür.
3. Crossfire
Regie: Edward Dmytryk
Drehbuch: John Paxton
Darsteller: Robert Young, Robert Mitchum, Robert Ryan, Gloria Grahame
Jahr: 1947
Motive: keine noir-typischen. Treppen vielleicht, und Hell-Dunkel-Kontraste.
Frauen: zwei. Brave Ehefrau und ruppige Animierdame mit Herz. Beides Nebenrollen.
Bechdel-Test: nicht bestanden.
Plot: Ein Mann wird in seiner Wohung zu Tode geprügelt. Die Polizei untersucht den Fall; der Ermittler ist angenehm zurückhaltend und sachlich. Hat aber beständig eine Pfeife im Mund, damit man auch sieht, dass er ein intellektueller Ermittler ist. Da war mir schon klar, dass das kein film noir werden würde. Pfeifen sind nicht noir, auch wenn Marlowe in den Romanen Pfeife raucht.
Hauptpersonen des Films sind aber eine Gruppe von Soldaten zum Ende ihres Militärdiensts, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Einer von ihnen ist der Tatverdächtige, ein anderer ermittelt selbst ein wenig herum, auch der tatsächliche Täter ist unter ihnen. Das weiß man schon recht früh im Film, ebenso wie das letztliche Motiv: Antisemitismus. (In der Romanvorlage, sagt man mir, istes Homophobie.) Gelegentlich neigt der recht kompliziert aufgebaute Film zum Didaktischen.
Erzählperspektive: Holla, auch hier wird mit Rückblenden gearbeitet, hier sogar dieselbe Szene aus verschiedener Perspektive, wenn auch noch ganz ohne Rashomon-Unschärferelation.
Der Film hat die typische Noir-Ausleuchtung (angeblich auch, weil die so leicht aufzubauen war; Drehzeit für den ganzen Film waren nur 20 Tage), aber noir ist er eigentlich nicht.
Anders als bei den vorhergehenden zwei Filmen fehlt diesem das Unausweichliche. Burt Lancaster sieht seinen Tod kommen, auch das Schicksal von Fred MacMurray kommt absehbar und unerbittlich auf ihn zu.
4. The Big Steal
Regie: Don Siegel
Drehbuch: Geoffrey Homes und Gerald Drayson Adams
Darsteller: Robert Mitchum, Jane Greer, William Bendix
Jahr: 1949
Motive: Keine typischen noir-Elemente. Kein Regen, keine Treppen, keine typische Ausleuchtung (ich habe den Film koloriert gesehen); er spielt tagsüber, es ist hell. Er spielt zu einem großen Teil auf dem Land, Überlandfahrt in Mexiko.
Frauen: Eine. Als selbstständig und selbstbewusst charakterisiert, außer wenn es um Schusswaffen geht. Jane Greer ist übrigens ganz entzückend, warum hat mir das noch keiner gesagt?
Bechdel-Test: nicht bestanden.
Erzählperspektive: linear, wenn auch mitten in der Handlung beginnend und zügig erzählt.
Plot: William Bendix verfolgt Robert Mitchum, wir wissen noch nicht, worum es geht. Schon da kann das kein film noir sein – wer 180 Radioepisoden von „The Life of Riley“ mit Bendix und seiner unverkennbaren Stimme in der Hauptrolle gehört hat, der sieht ihn nicht mehr als bedrohliche Figur. Wikipedia nennt den Film dann auch „film noir/comedy“.
Mitchum verfolgt seinerseits Patric Knowles, der sich mit gestohlenem Geld davonmacht. Er schuldet auch Jane Greer Geld, sie und Mitchum raufen sich zusammen und jagen Knowles hinterher. Eine Komödie ist der Film sicher nicht, aber es gibt viele witzige Szenen. Der charmant-gemütliche mexikanische Polizeichef gibt sich etwas einfältig, hat die Situation aber weitgehend unter Kontrolle. Nur das Finale ist echter Krimi, mit dubiosem Antiquitäten sammelnden Hehler und ein bisschen Verrat, aber das auch nur sehr kurz. Danach Happyend. Als Film durchaus in Ordnung.
5. Murder, My Sweet
Regie: Edward Dmytryk (sein Erstling)
Drehbuch: John Paxton
Romanvorlage: Raymond Chandler
Darsteller: Dick Powell
Musik: Roy Webb
Jahr: 1944
Motive: So ziemlich alle. Außer Regen. Immer noch kein Regen.
Frauen: Zwei, einschließlich femme fatale.
Bechdel-Test: nicht bestanden.
Erzählperspektive: Rückblickende Rahmenhandlung.
Plot: Philip Marlowe, einen Verband um die Augen, sitzt bei der Polizei und erklärt den Polizisten die näheren Umstände eines Mordes. In einem großen Rückblick wird die Geschichte erzählt. Moose Malloy, nach acht Jahren wieder aufgetaucht (aus dem Gefängnis?) will, dass Marlowe seine Freundin Velma findet. Bis er sie findet, gibt es Tote. Ich könnte mehr erzählen, aber das ist bei Chandler nicht sehr wichtig, und der Film folgt recht genau der Romanvorlage, Chandlers Murder My Sweet. Wichtiger ist die Atmosphäre: Los Angeles bei Nacht, Straßenschluchten, Bars. Die Kameraperspektiven sind mitunter schräg (Will Eisners Spirit-Comics nicht unähnlich), es beginnt gleich mit einer Vogelperspektive. Spiegel, Treppenfluchten, Tiefenschärfe, optisch interessant, vor allem auch eine Traumsequenz, als Marlowe unter Drogen in einem Sanatorium festgehalten wird.
Dick Powell macht sich als Detektiv gut, bis zu diesem Film war er Sänger und Musical-Star, wollte aber ins ernsthaftere Schauspiellager. Den smarten Schönling kann er nicht ganz ablegen, aber das passt dann doch gut zu Marlowe. Chandler selbst wünschte sich in einem Interview Cary Grant als Verkörperung für seinen Helden.
Gestört hat mich in der zweiten Hälfte des Films die Charakterisierung der Methoden. Der übliche Vorwurf der schönen Frau an den schmutzigen Detektiv, er würde für Geld ja wohl alles machen, kam sehr unmotiviert, ähnlich wie andere Versatzstücke. Trotzdem insgesamt ein sehr schöner Film und feiner noir.
Irgendwann komme ich hoffentlich dazu, die letzten vier Filme aus der Box anzuschauen. Eine erste kleine Zusammenfassung: Crossfire ist der einzige Film, der unmittelbar mit einem Mord beginnt. Alle anderen lassen sich Zeit. Noch interessanter: sehr viele der Filme erzählen nicht rein linear, eine rückblickende Rahmenhandlung gibt es fast immer, meist auch noch Rückblenden, bei Crossfire und The Killers als ganz wesentliches Element. (Beim ganz ausgezeichneten Out of the Past wird mir das wieder begegnen.) Liegt das an der Entstehungszeit oder doch eben am Genre? Die Männer und Frauen dort haben jedenfalls alle eine Vergangenheit; das Unausweichliche wird im Rückblick deutlicher; die Aufklärung eines Kriminalfalls ist ohnehin immer analytisch nach hinten gewandt.
Typisch auch der Antagonismus gegenüber den Behörden. Frauen sind gefährlich, Treppen ominös. Und es regnet nicht viel; die Idee des Regens habe ich wohl tatsächlich nur aus den Spirit-Comics von Will Eisner, in deren Noir-Atmosphäre es so beständig und heftig regnet, dass dafür der Begriff „Eisnershpritz“ geprägt wurde.
Nachtrag: hier die restlichen Filme.
Schreibe einen Kommentar