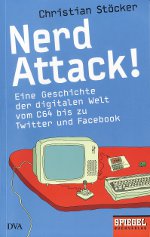 Es hat mir großes Vergnügen bereitet, dieses Buch zu lesen. Der Titel ist launig und kann eigentlich nur eine Idee des Verlags gewesen sein. Aber sonst ist das Buch gut; ich weiß nur noch nicht, wem ich es empfehlen soll.
Es hat mir großes Vergnügen bereitet, dieses Buch zu lesen. Der Titel ist launig und kann eigentlich nur eine Idee des Verlags gewesen sein. Aber sonst ist das Buch gut; ich weiß nur noch nicht, wem ich es empfehlen soll.
Christian Stöcker zieht eine Verbindung von den Commodore-64-Nutzern der frühen 1980er Jahre bis zu den besonders aktiven Internet-Nutzern der Gegenwart. Zwar beginnt er seine Geschichte der digitalen Welt schon einige Jahre zuvor, aber die Zäsur in Deutschland sieht er beim C64, und er ist ebenso wie ich ein Kind dieser Generation.
Das waren die ersten zwei Überraschungen für mich: Erstens, dass das Umgehen von Kopierschutzmaßnahmen und das Tauschen von Material keine Erfindung der Kostenloskultur im Internet ist, sondern viel älter. Das hatte ich vergessen oder nie so gesehen. Ohne eine Spur von Unrechtsbewusstsein tauschten wir Spiele und Tipps, getrieben von Neugier darauf, was es alles gibt, was alles möglich ist mit dem Ding.
(Ein Cracker war ich nie. Ich spielte und tauschte, war aber in der Verwertungskette ganz unten. Zweimal war ich bei echten Nerds, die nicht so hießen, in der Wohnung – das waren Leute, die Lötkolben herumstehen hatten und Eprom-Brenner und volle Schreibtische.)
Die zweite Überraschung war, dass es möglicherweise mehr so Leute wie mich gab. Im Kaufhaus standen wir eh alle vor den Rechnern herum. Aber auch die anderen Beschäftigungen, die Stöcker nennt, kannte ich, bis hin zu den Details: Rolemaster, Call of Cthulhu, D&D, DSA, Steve Jackson Games – alles alte Bekannte. Und das Abhängen in Läden für gebrauchte Taschenbücher, Heftromane und Comics. SF-Autoren und -Filme sowieso.
(Und da ist es auch, wo die Computer-Nerds und ich verschiedene Wege gingen. Midgard fehlt in der Liste der erwähnten Rollenspiele – Midgard ist ein Spiel, das aus dem Fandom kommt, und da habe ich mich dann herumgetrieben. Nicht wirklich bei Midgard, auch wenn ich ein paar Jahre Mitglied bei FOLLOW war, aber in der Science-Fiction-Fandom-Ecke: Magazine herausgeben, auf Cons gehen, Briefe schreiben. Das taucht bei Stöcker nicht auf.)
Offen bleibt: Warum sind die Deutschen so computerfeindlich? Stöcker liefert nur Ansätze zu einer Erklärung. Er vergleicht die Entwicklung in den USA, wo Individualisten und Hippies und Technikfreunde gemeinsame Interessen entdeckten und als digitale Bürgerrechtsbewegung die Electronic Frontier Foundation entstand, mit Deutschland, wo Computer ein Mittel der Unterdrückung waren (Volkszählung und so weiter) und 1985 der erste mitgebrachte Computer in den Räumen der Bundestagsgrünen wieder entfernt werden musste, weil Teufelszeug.
Weitere Themen des Buches sind: der Umgang mit Daten, die Piraten, das Urheberrecht, Anonymous, kastrierte Rechner. (Kastrierte Rechner: Computer, die naturgemäß alles können, aber nicht alles dürfen.) Sachlich und doch begeisternd geschrieben. Ich bin aber auch leicht zu begeistern. Eine These eher am Rande ist die: dass es eine Nerdkultur gibt, innerhalb der man bestimmte Themen als bekannt voraussetzen darf. Star-Trek-Episoden, die wichtigsten Superhelden, die wichtigsten Science-Fiction-Werke, Fernsehserien. Meine Frage: Wenn das denn stimmt, ist es dann Zufall, dass sich Computerbegeisterte zu großem Teil auskennen auf diesen anderen Gebieten? Gibt es ebenso viele Weinkenner-Computernerds und Angler-Computernerds und Auto-Computernerds? Ist ein Nerd, um mal weiter diesen Begriff zu benutzen, einfach jemand, der Experte auf irgendeinem Gebiet ist, oder muss das Gebiet einfach nur obskur genug sein, oder muss es tatsächlich Science Fiction usw. sein?
Nach der Lektüre des Buches habe ich mich jedenfalls gut gefühlt. Weil ich mich als Teil einer Geschichte und Entwicklung sah. Und musste gleich Frau Rau einen Kuss geben, weil es so schön ist, dass die auch so eine ist. Möglicherweise nicht von Geburt an, aber inzwischen.
Schreibe einen Kommentar