Monat: Februar 2011
-
Deutliche Worte zu Guttenberg
(12 Kommentare.) https://www.youtube.com/watch?v=6cDZuQBtpVA Nachtrag: Video vom Bayerischen Rundfunk aus unbekannten Gründen von Youtube entfernt. Hier noch zu sehen. (Prof. Dr. Oliver Lepsius) (Kognitive Dissonanz.) Für uns an der Schule ist diese Affäre ein willkommenes Lehrstück. Plagiate kommen in Deutschaufsätzen ab der 10. Klasse vor, und in Referaten sowieso. Tatsächlich scheinen manche Schüler ganze Passagen aus…
-

St. Quirin
Wenn das bayerische Kabinett sich in Klausur begibt, um über den Finanzhaushalt zu beraten, geht es nach St. Quirin in Gmund am Tegernsee. So sieht es da aus: Aber natürlich kann man nicht immer über Finanzen tagen. Alltags ist das Haus im Ortsteil St. Quirin ein Bildungszentrum der Bayerischen Staatsregierung. Dort finden Fortbildungen, Tagungen und…
-

Heute Vorlesung
(1 Kommentare.) Heute haben wir mit ersten Vorlesungen begonnen, von denen ich weiß, dass andere Schulen damit schon länger experimentieren: probehalber, für die Q12, im Rahmen einer jahrgangsinternen Ringvorlesung. Wir haben erst mal die scheidende Referendarin vorgeschickt, weil wir Schisser sind ihr Gelegenheit zu einer Abschiedsveranstaltung geben wollten. Sie hat das auch sehr gut gemacht.…
-
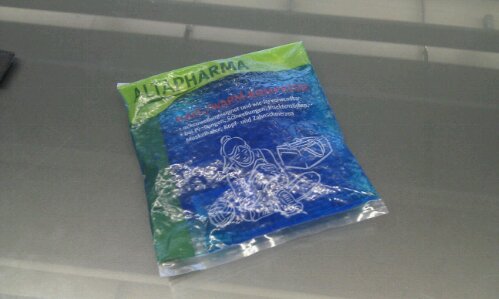
Blaue Beutel
(19 Kommentare.) Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, vor fünf, sechs Jahren. Jedenfalls haben wir seitdem stets ein halbes Dutzend Kühlbeutel im Eisfach im Lehrerzimmer. Die werden schon sehr gut angenommen, werden rege ausgegeben und wieder zurückgebracht. Ich weiß nicht, ob die Schüler sich heute mehr verletzen als früher, wir kamen jedenfalls ohne aus…
-
Motivationscoach an der Schule
(4 Kommentare.) So ähnlich muss es früher gewesen sein, vor hundert Jahren in den USA, als ein Wanderprediger in die dörfliche Gemeinschaft kam, ein Zelt wurde aufgebaut, das Harmonium herausgeholt, und dann begann die Show: Gestern war ein Motivationscoach an unserer Schule. Zugegeben, ich war nicht die Zielgruppe. Die Witze kannte ich schon und inhaltlich…
-
Von Kopf und Herz, oder: Warum lesen wir Nathan in der Schule?
(10 Kommentare.) Vor einigen Jahren trieb man in der 11. Klasse im neunjährigen Gymnasium Aufklärung und las dazu häufig Nathan der Weise von Lessing. Ein Stück, das ich mag – weniger wegen der Ringparabel, die ich für überschätzt und nicht besonders anschaulich halte und die mir in ihrer Religionskritik nicht weit genug geht. Aber der…
-
Literarisches Quartett in der Schule
(4 Kommentare.) Heute gab es eine etwas durcheinandere Stunde wegen Doppelbuchung des Computerraums. Wir haben zwar eine Liste, in die man sich eintragen kann, aber manchmal werden kurzfristig Stunden getauscht, ohne auf diese Liste Rücksicht zu nehmen – was technisch auch schwierig wäre; ich habe selber noch keine Lösung für dieses Problem. Da wir in…
-

Wolfgang Herrndorf, Tschick
(92 Kommentare.) Nachdem ich das Buch im Dezember kurz erwähnt hatte, habe ich inzwischen mit meiner 9. Klasse verhandelt, so dass es jetzt unsere Klassenlektüre ist. Dagegen spricht der Preis, das Buch gibt es bisher nur gebunden. Aber ich halte es für eine sehr geeignete Lektüre. Zuerst einmal deshalb, weil das Lesen Spaß macht. In…