Meine zweite neu angelegte Wikipedia-Seite, ich hoffe, sie hat genug Relevanz. Deshalb wiederhole ich nicht, was bei Wikipedia zum Buch steht; hier nur Ergänzungen und ein bisschen Analyse oder zumindest Zitate.
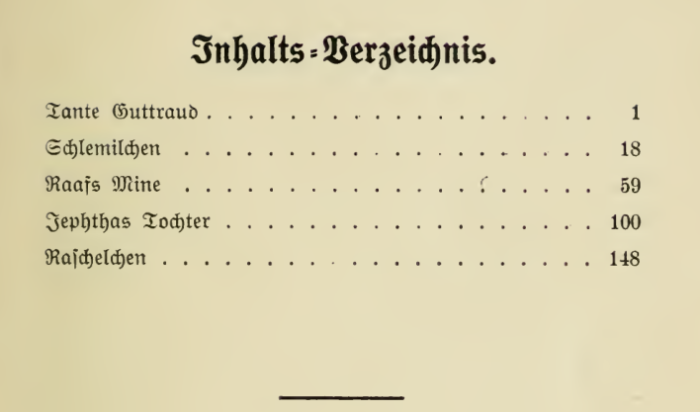
Die Erzählungen geben Einblick in das klein- und kleinstbürgerliche jüdische Familienleben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in und um Kassel herum. Drei der fünf Erzählungen beginnen mit einer alten Frau, deren Geschichte daraufhin erzählt wird. Die erste, Tante Guttraud, ist dem jungen Erzähler noch nicht wichtig: „Die Großtante stand unseren kindischen Interessen fern; sie ragte nur um eines Fischkopfs Länge und eines Apfels Schwere in unser Leben hinein.“ – Den Fischkopf kriegt sie als Leckerbissen aus unbekannten Gründen jeden Schabbatabend; der Apfel ist das Geschenk für die Kinder bei der Übergabe. Zwanzig Jahre später erfährt der Erzähler die Vorgeschichte. Auch in der letzten Erzählungen geht es um eine alte Frau und ihre Vorgeschichte; auch hier tritt, ganz am Ende, der Ich-Erzähler in Erscheinung, als er sie auf dem Friedhof trifft.
Alle Erzählungen haben Frauen als Hauptpersonen. Einigen bleiben Heirat oder Kinder versagt, obwohl sie sie sich wünschen. Die „Sehnsucht, in der großen Kette der endlosen Menschheit nicht wie ein abgefallener Ring zu Boden zu fallen,“ wird nicht erfüllt, oder erfüllt sich in Ersatzhandlungen.
Themen sind Emanzipation, Assimilation, Moderne versus Tradition. Das betrifft auch die Sprache:
»Mach‘ keine Schnütchen, Minkel,« sagte er, »thu‘ mir den Gefallen und red‘ nit hochdeutsch!«
»Soll ich jüdisch reden?« fragte sie.
»Worum nit?« brummte jener.
In einer Geschichte geht es um einen fortschrittlichen Studenten, der später auch ein vorbildlicher Rabbi wird, die zerstrittende Gemeinde eint und auch die orthodoxeren Mitglieder mitnimmt:
Aber braucht unsere Zeit noch diesen Kultus des todten Buchstabens? Nein! Sie ist mit Riesenschritten über die Ameisenhaufen des talmudischen Pygmäenkrams hinweggeschritten, in denen unsere Gedanken zu wühlen verdammt sind. Ein neuer heiliger Geist flammt in jenen Gemeinden auf, die den erhabenen Gedanken des Judenthums aus seinen verwitterten Formen auferstehen lassen.
In einer anderen scheitert eine musikalische begabte Tochter an dem Zwang, sich zwischen der frommen Mutter und dem nichtjüdischen, ihre Karriere fördernden Geliebten (der sich hier aber auch deutlich als Ekel zu erkennen gibt) zu entscheiden:
»Bleibt, wenn ihr wollt, in eurer Judengasse! Und deßhalb habe ich dieß Talent wie eine Perle aus dem Schlamm gezogen und deßhalb sie zu dem großen Meister geführt und deßhalb zwei Jahre lang mit ihr in Mozart, Beethoven und Haydn geschwelgt. Großer Genius!« rief er und schleuderte die Noten vom Pult auf die Erde, »verzeihe ihnen, sie wissen nicht, was sie thun!« […] »Es muß in dieser Stunde entschieden sein, die Fesseln, die Dein Herz und Deinen Genius gefangen halten, müssen gebrochen werden, brich sie, geliebtes Mädchen, wie ich mich losreiße von den Vorurtheilen der Welt gegen Deine Nation! Sei mein Weib!«
Scanfehler im deutschen Gutenberg-Text
Einmal „französichen“ statt „französischen“, einmal „Helden“ statt „Heiden“, und einmal „Schlemilte“ statt „Schlemile“ – letzterer hat es wohl auch in die Neuausgabe von 2001 gebracht. Ich halte das zumindest mal hier fest.
Notizen zur Sprache
Es gibt einen Farbton,“Caca dauphin“, ein gelbgrünes Braun, Modefarbe zur Zeit von Marie Antoinette. Benannt nach der Farbe der gefüllten Thronfolger-Windeln. Wird einmal für einen aus Frankreich mitgebrachten Schal verwendet, ganz normal und neutral verwendet.
»Ist das Euer Kind, Tobiah?« fragte sie mit hochdeutschem Accent.
»Das ist meun Kind,« antwortete er parodirend.
Wie war die jiddische, oder jiddisch gefärbte, oder auch nur hessische Aussprache sonst? /aɪ̯/?
Der Begriff „Schlemihl“ wird ausführlich erklärt:
Chamisso hat das Wort in die deutsche Literatur eingebürgert, indem er den seelenguten Menschen schilderte, der unselig durch’s Leben wandern muß, weil ihm – ein Schatten fehlt! Ja, dem »Schlemil« fehlt nichts als ein Schatten oder vielmehr ein Licht, ein Glanz, ein Duft, den die Grazien über den Sterblichen hauchen, wenn sie an seiner Wiege stehen.
Der Text enthält viele, viele jiddische und hebräische Ausdrücke, jeweils sorgfältig in Klammern übersetzt. Daneben sind auch regionale deutsche Wörter oder Eindeutschungen in Klammern angegeben, ebenso wie die englischen Einsprengsel eines aus Amerika Zurückgekehrten – mitunter interessant, was wie erklärt wurde und was nicht. Hier jeweils ziemlich kontextlos die Zitate aus dem Buch.
Deutsch
- »Bullengrün« (bowlinggreen)
- cummelfo (comme il faut)
- sennen (sind)
Englisch
- Ich habe mich bothern (quälen) und plagen müssen
- bei vergangenen Dingen ist mein Grundsatz, zu overpassen (pass over); ich bin nicht hergekommen für ein sentimental journey, sondern für business
- Ich habe keine Lust, mich hier lang zu stoppen (stop), noch weniger, mich hier zu setteln (settle) und so ein frippery-box weiterzuführen
Jiddisch oder Hebräisch (vieles doppelt)
- Freitag Abends nach der »Schul« (Gottesdienst)
- Ausruf ›Jidde, Jidde!‹ (Jude)
- ehe Ihn unsere Saunim (Feinde) verdammen
- Gott soll M’schomer und mazil sein (Gott verhüte es),
- ich bin sein Weib und hab‘ Ihm unter der Chuppe (Trauhimmel) Treue geschworen
- Sind wir Gojim (Heiden)
- Wie ich denke, denkt jede, die nicht newajisch haschem (Gotteslästerin) ist.
- Er ist takif (beliebt) beim Bürgermeister. Beim Parneß (Gemeindevorsteher) bin ich umsonst gewesen
- den sie für den größten Rosche (Judenfeind) ausgeschrieen haben,
- nichts treifes (Verbotenes) zu essen. Und nun sei mauchel (verzeih‘),
- Nur am Abend von Roschhaschonu (Neujahrstag)
- Nur bei den Owinu-Malkeinu’s (Bitt- und Bußlitanei)
- Kurz nach Sukkos (Laubhüttenfest)
- Er war für die ganze Gemeinde ärger als
Tischi-b’afTischo-b’af (Zerstörung Jerusalems). - Raf (Rabbiner)
- was man darüber für eine Broche (Segensspruch) machen soll.
- als wenn man Kaurim fällt (der Fußfall am Versöhnungstag),
- Betty, was thust Du für eine Ewere (Sünde)!
- »Wie heißt die Menuwelte?« (Häßliche)
- das Gan-Eden (Paradies)
- Purimfestes (jüdischer Fasching)
- Meschores (Diener)
- Grieben (Grammeln)
- »Kidesch-Wein« (zum Segensspruch)
- Schatchonim (Heirathsvermittler),
- »Netinge« (Mitgift)
- »Wälschen« (Truthahn)
- Schidech (Heirath)
- Strauß von Syringen (Flieder)
- der Chosen (Bräutigam) schlagt die Kalle (Braut)
- »Knaß gelegt!« rief Onkel Markus laut lachend, »Massel (Glück) und Broche (Segen)!« (Das Knaßlegen ist eine Zeremonie bei Verlobungen, bei welcher ein Glas oder eine Schale zerbrochen wird.)
- Massel (Glück) und Broche (Segen)!
- Sechus (Fürbitte)
- Chosid (Frommer)
- Es ist ihm übel geworden und er hat doch nicht angebissen!« (Ausdruck für das Fastenbrechen am Versöhnungstag.)
- »lernen« (beten)
- »Menachum owel« zu sein (die Trauernden zu trösten),
- Schiwe (siebentägigen Trauer)
- Jeden Abend »aumerte« (zählte) Frau Jochebedchen
- meoalofim (Hunderttausend)
- »Schem jischmerenu!« (Gott unser Schützer)
- Zu Massel (Glück) und zu Broche (Segen)!
- Tochter des alten Raaf’s (Rabbiners)
- der Schammes der Gemeinde (Tempelordner)
- eine kurze Drosche (Rede)
- Zu Hause paskente (entschied)
- Worum nit (Warum nicht)
- trefe (unrein)
- Die Rebzen (Frau des Raaf’s)
- Boles (Krapfen),
- Jeschive (Talmudschule)
- die neumodischen Schmus (Reden)
- das hochdeutsch darschent (predigt)!
- Charbe und Busche (Schmach und Schande)
- Auscher (Reicher)
- Posche Jisroel (Sünder)
- menachem owel zu sein (zu kondoliren)
- Schiwe saß (die siebentägige Trauer)
- Arbocanfes (Brustlatz mit Gebetfäden)
- Jeworechecho (Gott segne dich!)
- Sidurl (Gebetbuch)
- Rabbonim (Rabbiner)
- Kle-kodesch (Paramente)
- halb Hallel« zu sagen (Lobgesang)
- Tfille (Gebetbuch)
- olewescholem (der Friede sei mit ihr)
- Stuß (Unsinn)
- ein großer Chochem (klug)
- Chammer (Dummkopf )!
- Schir-hamalaus (Lobpsalm),
- Schma Jisrol (Höre, Israel)!
- Kol (Stimme)!«
- Stuß (Narrheit),
- Pschide (freilich)
- Oser (Verneinungsschwur)!
- Stuß (Possen)!«
- Soton (Teufel),
- ein Jausem (Waise),
- Chauf (Schuld)
- takif (beliebt)
- Mahd (Magd)
- Tachlis? (praktischen Zweck)
- nebich (leider)
- mieß (häßlich)
- gebenscht (gesegnet).
- des jüngern Chassens (Kantors)
- lecho daudi (Empfangshymne des Sabbaths)
- Sein Sie mauchel (verzeihen Sie)
- Godelkum (Willkomm)
- Kelef (Hund)
- brauches (gespannt)
- Tfillim (Gebetriemen)
- So ein Schlaganfall ist immer erev Tod (Vorabend)
- Gehenom (Hölle).
- Nekome (Schadenfreude)
- meschugge (verrückt)
- oren (beten)
- die Widde (Sündenbekenntniß)
- so bin ich mich menadder (gelobe ich),
- ich will Gaumel berschen (das Gebet für Rettung aus Todesgefahr verrichten)
- mein aulom habo (Seelenheil)
- madder sein (lösen) lassen
- wie an I’me hamabul (zur Zeit der Sintflut)?
- Schiwerlef (Herzeleid)
- Rosche (Bösewicht)
- Godelkum (willkomm)
- Jechaules (Kraft)
- Ihr seid jauze (frei)
- Taures Mausche (heilige Wahrheit).«
- dem »bösen Blick« (Ajin hora)
- die erforderliche Zehnzahl (Minjan)
- Broche machen (Segen sprechen)
- Tachschid (Herzblatt)
- Lau kom (das steht nicht wieder auf)! Gott! die Sechie (Freude)! – Wenn mein Vater das hörte, er wär‘ mir Alles mauchel (er verziehe)! – Hör‘ Einer den Ton! – Das ist Kischev (Hexerei) und seh‘ Einer das Gesicht! Ganz wie Er! – Der Chein von Jossef (die Grazie Joseph’s)! Mein Reinchen – mein‘ Perl, Gott erhalt‘ Dich, Omen weomen (Amen)!«
- Schabbes (Sabbath)!«
- Der Goi (Christ)!
- Tifle (Kirche)
- olewescholem (der Friede mit ihm!)
- Nijen (Synagogenweise)
- Kowed (Ehre)
- Luech (Kalender)
- Kidusch Haschem (Verherrlichung Gottes),
- paskenen (auslegen)
- »Stuß« (Thorheiten)
- Schmus periendis ( pour rien dits, nichtssagende Reden)
- Gott soll meschomer sein! (behüt’s)
- Gott wird mir’s mauchel sein (verzeihen),
- die Akeite (das Opfer Abrahams)
- seinen Malach (Engel)
- mauchel sein (verzeihen).
- Kibet Av Em (Ehre Vater und Mutter)
- Chassen (Kantor)
- Kol (Stimme)
- Mimmle Madel (Mühmchen Madelon),
- geort (gebetet)
- Milchome (Krieg).
- die Neschom (Seele)
- Schiwerlef (Herzeleid)
- newich (leider)
- Gott soll’s ihm mauchel sein (verzeihen),
- Mausche ribenu (Moses, unserem Lehrer)
- Nekome (Schadenfreude)
- mein Massel und meine Broche (Glück und Segen),
- wie Schippe-Malke (die Piquedame ist das Symbol der Pracht)
- Ewere (Sünde),
- Jaum-Din (Tag des Gerichtes) wird Dein Sechus (Verdienst)
- Stuß (Thorheit)
- Mizwe (fromme That)
- Gott ist ein Schaufet Zedek (gerechter Richter),
- Kalle (Braut)
- Gaiwe (Stolz)
- Schiwerlef (Herzbruch)
- Ewere (Sünde)
Gekommen bin ich auf das Buch durch zwei Absätze in einem Aufsatz von Ruth Klüger, die dann später auch ein Nachwort zur ersten deutschsprachigen Neuausgabe seit fast hundert Jahren geschrieben hat. Wie ich auf das Klüger-Buch gekommen bin, das weiß ich nicht mehr. Irgendwas im Web?
Schreibe einen Kommentar