Aus dem Bücherregal meiner Eltern, späte 1970er Jahre. Ich habe das als Kind gelesen, so mit zehn, elf, weil ich den meisten Büchern in diesen Regalen eine Chance gegeben habe, und dieses habe ich sehr gerne und mehrfach gelesen, auch weil mir die beschriebene Welt dort so völlig fremd war. In der kleinen Stadtbibliothek habe ich dann die Fortsetzungen entdeckt und zumindest ein paar davon gelesen; es gibt insgesamt acht Bände aus der Reihe, wobei der letzte, posthum erschienene, nicht mehr von Fitzgerald geschrieben ist und auf Notizen beruht. (Wikipedia zur Reihe.) In meiner Phase des Wiederlesens habe ich auch dieses Buch noch einmal gelesen. Es erschien 1967 und wurde wohl schnell ein Bestseller.
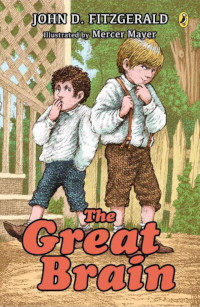
Die Geschichten sind einzelne Episoden, nur durch Schauplatz und Personal und gelegentliche Rückgriffe auf Geschehenes verbunden, demnach chronologisch angeordnet. Sie spielen ganz am Ende des 19. Jahrhunderts in einer Kleinstadt in Utah (zeitlich ein Stück näher an Unsere kleine Farm als an den Waltons), zweieinhalb Tausend Einwohner, die meisten davon Mormonen. Die Familie des Erzählers ist katholisch, aufgeschlossen, modern, der Vater Herausgeber der örtlichen Zeitung; der Erzähler aller Geschichten ist der siebenjährigen Tom, und die zentrale Figur ist stets dessen zehnjähriger ältere Bruder Tom, Spitzname „the Great Brain“, deutsch: „der Kopf“. Tom ist je nach Sichtweise ein überaus gescheiter, charmanter Lausbub, oder ein egoistischer, manipulativer Betrüger; das interpretieren moderne Lesende vielleicht anders als zum Zeitpunkt des Erscheinens.
Die Geschichten
- Tom kassiert Geld von den Nachbarskindern als Eintritt für die neueste Attraktion der Kleinstadt, und für die von seiner Mutter gebackenene Kekse. Am Schluss muss er aber alles zurückzahlen und macht sogar Verlust. – Kernstück der Geschichte ist aber einfach diese Attraktion: das erste Wasserklosett der Stadt, im Versandhandel bestellt und vom Vater und einem Klempner installiert. Dafür werden: ein Raum ausgewählt und abgetrennt, Schüssel aufgestellt und Wassertank aufgehängt, Rohre verlegt. Die halbe Stadt schaut bei der Lieferung zu, alle schütteln den Kopf, die Familie fürchtet, dass sich der Vater mit seinen neumodischen Ideen zum Gespött der ganzen Stadt macht – aber tatsächlich funktioniert. Ein schönes Stück Zeitgeschichte.
- Tom hat ein Arrangement mit zwei Nachbarsjungen, die immer zufällig just zu der Zeit vorbeischauen, wenn das sonntägliche Eis fertig gemacht ist, und beim Ausschlecken der Formen helfen. John findet heraus, dass sich Tom dafür bezahlen lässt, aber Tom erklärt ihm das so logisch, dass John ihn weiter für einen Wohltäter hält. (Viel zum Eismachen gelernt beim Lesen damals und heute: Man geht ins Eishaus, wo die im Winter geholten Blöcke lagern, 60 mal 150 Zentimeter, unter 60 Zentimetern Sägespäne zur Isolierung. Die schaufelt man zur Seite, sägt ein Stück Eis ab, schaufelt die Sägespäne wieder über den Rest, und wäscht die Sägespäne von den mitgebrachten Eisstücken. Damit wird dann Eiscreme gemacht, in einer Trommel, deren innerer Behälter mit den Zutaten gefüllt wird. Im äußeren Ring sind Eisstücke und Salz. Wieso Salz? Das wollte ich als Kind auch wissen! Diese Trommel wird dann mit einer Kurbel lange gedreht, bis innen die Eiscreme entstanden ist.)
- Tom bringt dem Sohn griechischer Einwanderer bei, wie man Englisch spricht, ein Amerikaner wird, und sich gegen die fremdenfeindlichen Bullys unter der Jugend zur Wehr setzt. Die Lösung: Sich mit ihnen prügeln, bis man gewonnen hat, und danach ist man ohnehin befreundet. Tom lässt sich das vom Vater des Jungen honorieren. Das mit dem Prügeln ist aus heutiger Sicht nicht vorbildhaft.
- Tom sorgt dafür, dass ein in einem Höhlensystem verirrtes Geschwisterpaar gerettet wird. Er lässt sich dafür feiern, und hat außerdem ein finanzielles Motiv für die Rettung.
- Tom nimmt Rache am neuen Dorfschullehrer, der ihn ungerecht behandelt hat. Dabei habe ich die Minzpastillenmarke „Sen-sen“ kennengelernt, die eine kleine Rolle spielt, und später bei Billy Joel, „Keeping the Faith“ wiedererkannt, in dem altmodische Sachen aufgezählt werden. Toms Eltern sind entsetzt, als sie die Einzelheiten erfahren.
- Tom bringt einem Freund, dessen Unterschenkel amputiert wurde (geheimgehaltene Verletzung beim Spielen in verbotener Scheune führt zu Blutvergiftung), bei, wie er seiner Familie auch mit dem Holzbein bei den Haushaltstätigkeiten helfen kann, so dass er sich nicht mehr als nutzlos empfindet (und seine Eltern ihn nicht mehr als nutzlos empfinden). Außerdem bringt er ihm bei, bei welchen Spielen und Wettkämpfen unter der Jugend er mitspielen und wie er sogar gewinnen kann.
- Eine nur passive Rolle spielt Tom in der Geschichte um Abie Glassmann, einen schon älteren reisenden Händler, der sich in der Stadt niedergelassen hat. Er ist Jude, aber das spielt zumindest scheinbar keine Rolle, ist jedenfalls kein Problem. Sein Geschäft geht wohl nicht so gut, er kauft weniger ein, bricht einige Male zusammen, verschwindet ein paar Tage von der Bildfläche – kurz, er stirbt an Unterernährung, weil er kein Geld hat und zu stolz ist, sich das anmerken zu lassen. Erst Toms Vater hat Zweifel am Verhalten der Stadt: hätte man nicht nach jedem anderen eher geschaut, sich mehr gekümmert, Sorgen gemacht? Aber bei Abie, der noch dazu eine geheimnisvolle Kiste verbirgt, gingen alle automatisch davon aus, dass der sicher Geld und hat und zurechtkommt. „But Abie was a Jew and so nobody worried about him. May God forgive us all.“
Tom Sawyer (1876)
Und jetzt muss ich wohl wieder zu Tom Sawyer greifen, zum Vergleich. Im Gegensatz zu Huckleberry Finn habe ich den seit meiner Kindheit nicht mehr gelesen, bin gespannt, was noch da ist. Ich erinnere mich, dass Tom und (schlägt nach) Becky sich auch in einem Höhlensystem verirren. Auch Tom und Huck schwören einen geheimen schauerlichen Schwur, wie er in einer Great-Brain-Episode auftaucht. Sie ritzen sich dazu, um das mit Blut zu besiegeln, und Tom lehnt die zuerst vorgeschlagene Messing-Nadel ab, weil er Angst hat, dass daran „Grünspan“ ist, auch ein Wort, das mir als Kind fremd war, und wenn man nur ein bisschen davon abkriegt, stirbt man. (Und eben erst gesehen, dass da im Original „verdigrease“ statt „verdigris“ steht, im Deutschen wohl nicht zu retten.)
Schreibe einen Kommentar