Neulich in Berlin, in der Pension, stieß ich auf das:

Mmmmh. Karl-May-Bände, und zwar die guten, exotischen. Mit Winnetou und Old Shatterhand konnte ich nicht gar so viel anfangen, auch wenn ich etliche der Wildwest-Romane mehrfach gelesen habe und mich dabei durchaus vergnügte. Aber die sechs Bände des Orient-Zyklus, die habe ich oft gelesen: Durch die Wüste, Durchs wilde Kurdistan, Von Bagdad nach Stambul, In den Schluchten des Balkan, Durch das Land der Skipetaren, Der Schut. Kurzer Test: „Hadschi Halef Omar ibn Hadschi Abul Abbas ibn Hadschi Dawud Als Gossarah“… na ja, fast: Wikipedia korrigiert einmal meine Rechtschreibung und ändert ein „ibn“ in „ben“, damit kann ich leben: Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah. (So nennt sich der Begleiter der Hauptfigur, auch wenn die vielen Hadschis im Namen eher Angabe waren als Realität. Wer Karl May gelesen hat, kann das auswendig sagen, auch noch fünfunddreißig Jahre nach der letzten Lektüre.)
In der Pension griff ich zu einem der Bände, die ich noch nicht kannte, Im Lande des Mahdi I: Menschenjäger. Und ich war gleich wieder drin. Fast so schön wie der Stimme des Erzählers auf der Hörspiel-Kassette zu lauschen, wie er – Wilhelm Hauff, Das Gespensterschiff – beginnt mit: „Mein Vater hatte einen kleinen Laden in Balsora“ und einem so richtig sonoren „o“ in „Balsora“. Jedenfalls liegen die drei Bände des Mahdi jetzt digital auf meinem Nachttisch, das möchte ich bald zu Ende lesen.
Aber eigentlich soll es hier um Kochbücher gehen. Erich Kästner hat ja ein umwerfendes erstes Kapitel oder Vorwort zu Emil und die Detektive geschrieben. Eigentlich habe er ja einen Südseeroman schreiben wollen, eine spannende Szene, in der ein „mit heißen Bratäpfeln geladenes Taschenmesser“ eine Rolle spielte, als er plötzlich nicht mehr wusste, wieviel Beine ein Walfisch hat. Aus war es es mit dem Schreiben, denn die Fakten müssen ja stimmen. Und so kam es nie zu Petersilie im Urlaub, dem durchaus interessant klingenden Südseeroman. Der Oberkellner Nietenführ erklärt dem Herrn Kästner darauf, dass man besser über das schreibe, was man kenne. Kästner entgegnet darauf, dass ja trotzdem Schiller erfolgreich über die Schweiz geschrieben habe – und, möchte ich als Leser ergänzen, der Karl May über den Orient und Amerika, obwohl er nie da war. Die Antwort des Oberkellners darauf: „Da hat er eben vorher Kochbücher gelesen […] Wo alles drinstand.“
Und recht hatte er, der Oberkellner, zumindest was die Kochbücher betrifft.
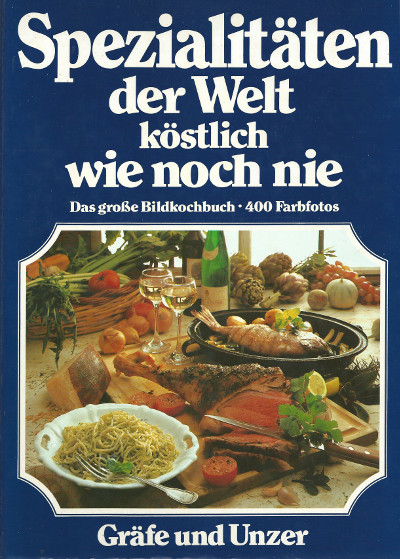
Spezialitäten der Welt köstlich wie noch nie. Christian Teubner, Annette Wolter. Gräfe und Unzer 1982.
Irgendwann habe ich angefangen, mich fürs Kochen zu interessieren. Erst kamen die Kochbücher, die ich gelesen habe, und dann die Lust, Dinge auszuprobieren, die ich in den Kochbüchern fand. Ein Favorit war Spezialitäten der Welt. Ich kann gar nicht aufzählen, was ich aus diesem Buch alles gelernt habe – nicht unbedingt über das Kochen, denn das Rezept für die Salzburger Nockerln gibt eine zu hohe Temperatur bei zu kurzer Backzeit vor, und das war natürlich eines der ersten Rezepte, die ich ausprobierte. (Peter Alexander, klar.) Nein, ich lernte viel über Geographie. Die Gerichte sind geographisch angeordnet: Südeuropa, Westeuropa, Nordeuropa, Osteuropa (Polen und Sowjetunion), Mitteleuropa (Deutschland, Schweiz, Österrich, Tschechoslowakei, Ungarn), Balkan, Vorderer Orient, Nordafrika, Schwarzafrika, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Südasien (Indien, Sri Lanka), Südostasien, Ostasien, Australien/Ozeanien. Die Titel der Gerichte jeweils auf Deutsch und in der Originalsprache.
Spaghetti mit Pesto, lang bevor das hier aufkam. (Wir erinnern uns: Das Buch stammt aus einer Zeit vor dem Döner in Deutschland, der am Anfang ohnehin noch Gyros hieß, vor Sushi, selbst Jahre vor dem Tex-Mex-Boom ab Mitte der 1980er Jahre. Chinesisch, das gab es.) Bei Spanien habe ich von Migas erfahren und von Nierchen. Portugal: Was Stockfisch ist. Die gebratenen Heringe aus England habe ich einige Jahre später in einer winzigen Jugendherberge dann mal vom Herbergsvater zubereitet gekriegt. Dass die in England ihren Pudding mit Rindernierentalg machen, und überhaupt: was ein Pudding ist. Und Cornish Pasties. Und Treacle Tart. Dass man in Dänemark eine ganze Mandel im süßen Reis versenkte. Was Anchovis sind (Schweden). Borschtsch, Blini. Quarkspeise zu Ostern. Was Kwass ist. Oder, wieder westlicher, eine Wähe. Ein Beuscherl (was man so alles essen kann). Baklawa zum Nachtisch, und Imam Bayildi, das ich später wiedererkennen sollte. Ein Bild von Lammfleischspießen mit Joghurtsauce, nach dem ich immer noch Hunger habe. (Pilaw kannte ich ja schon von Karl May.) Süße orientalische Desserts. Gefilte Fisch, Kreplach, Cholent und „Kihen fin Veisseriben“ (Pastinakenkuchen). Manches andere kannte ich schon von libanesische Bekannten meiner Eltern. Jambalaya, das Gericht noch vor Hank Williams oder, später, Jerry Lee Lewis. Als 2014 anlässlich der Weltmeisterschaft in Brasilien das Nationalgericht Feijoada vorgestellt wurde, habe ich gleich das Bild von S. 243 herausgesucht. Dann die Satéspießchen, erste selbstgemachte Erdnusssauce. (Nasi Goreng auf der Seite gegenüber kannte man ja eh schon seit irgendwann vor meiner Zeit.) Sashimi, roher Fisch. Komisch, dabei hieß das in Blade Runner doch Sushi… aber da war Blade Runner nicht ganz exakt.
Jetzt höre ich dann mal auf. Für so eine gesunde Allgemeinbildung und Neugier gegenüber anderen Ländern gibt es jedenfalls wirklich Schlechteres als solche Kochbücher zu lesen.
Empfehlenswert: Die Maisfritters von S. 230, die gewürzten Ananas S. 258.
— Gehört nicht ganz zum Thema, aber in die Zeit: „Zuppa Romana“ (1984) von Schrott nach 8.
Schreibe einen Kommentar